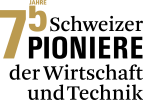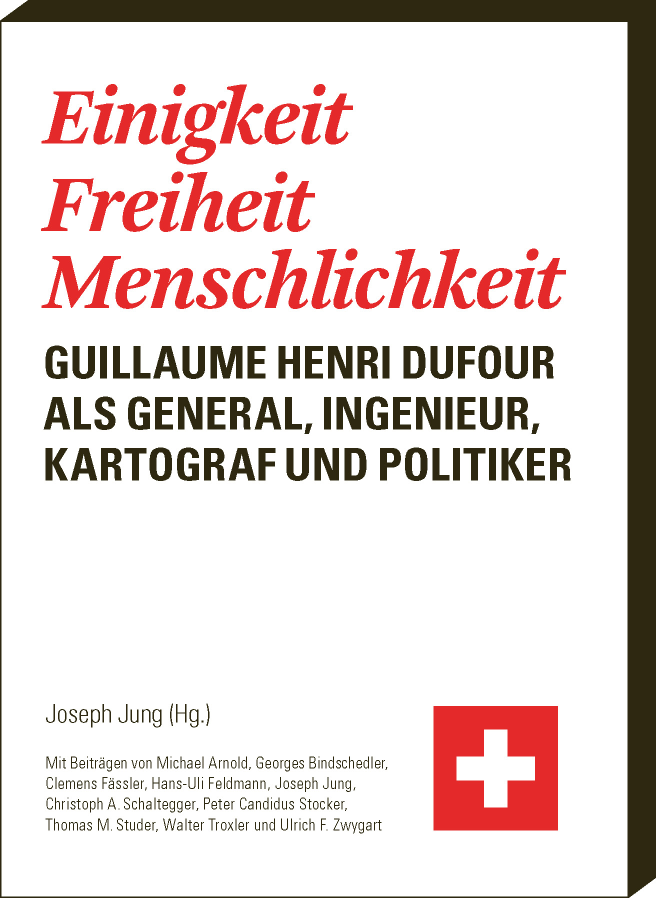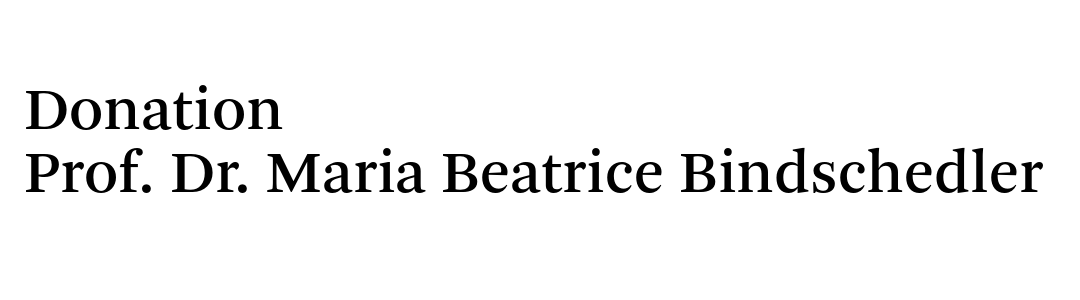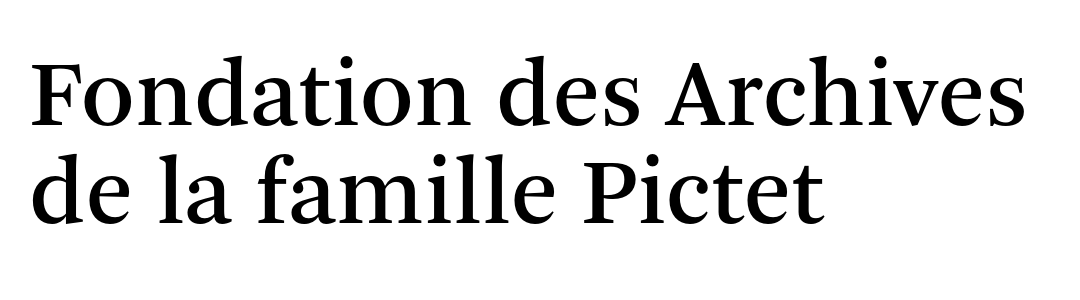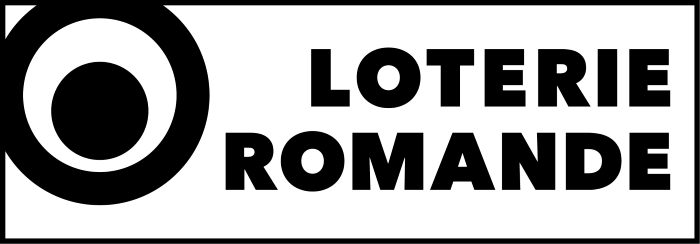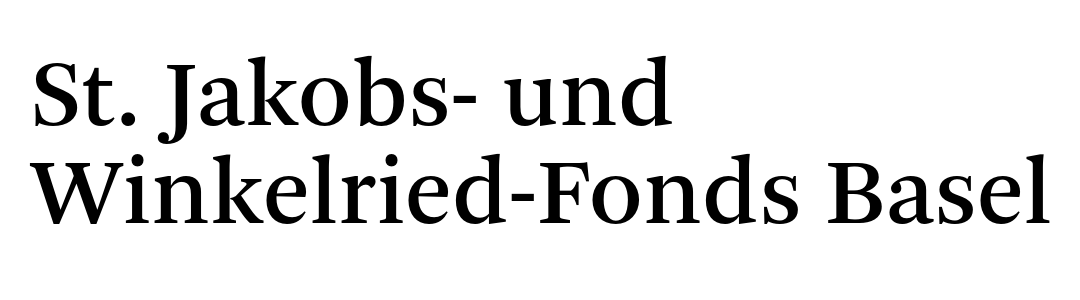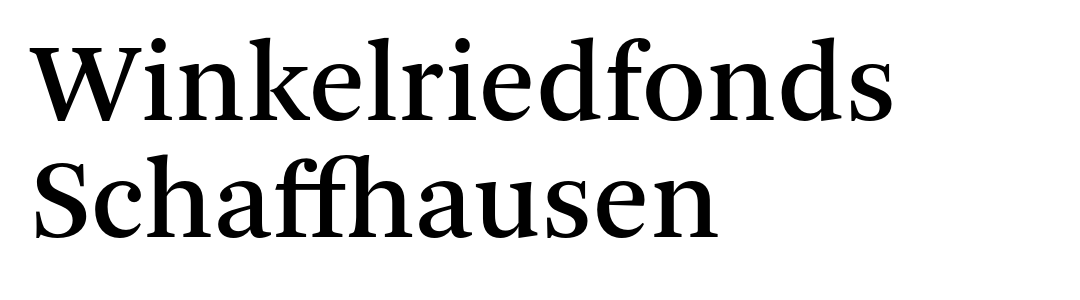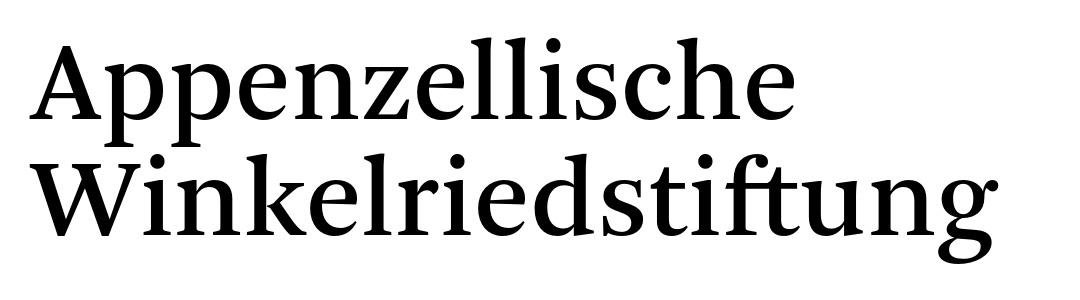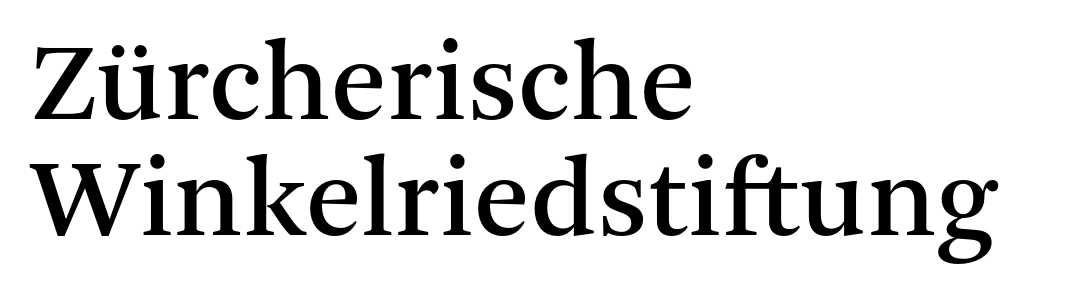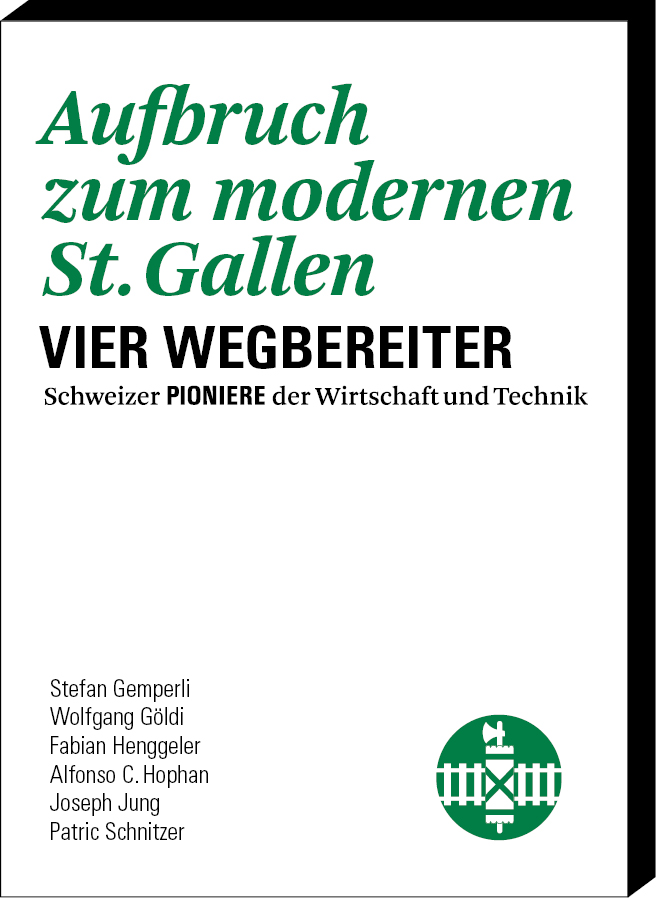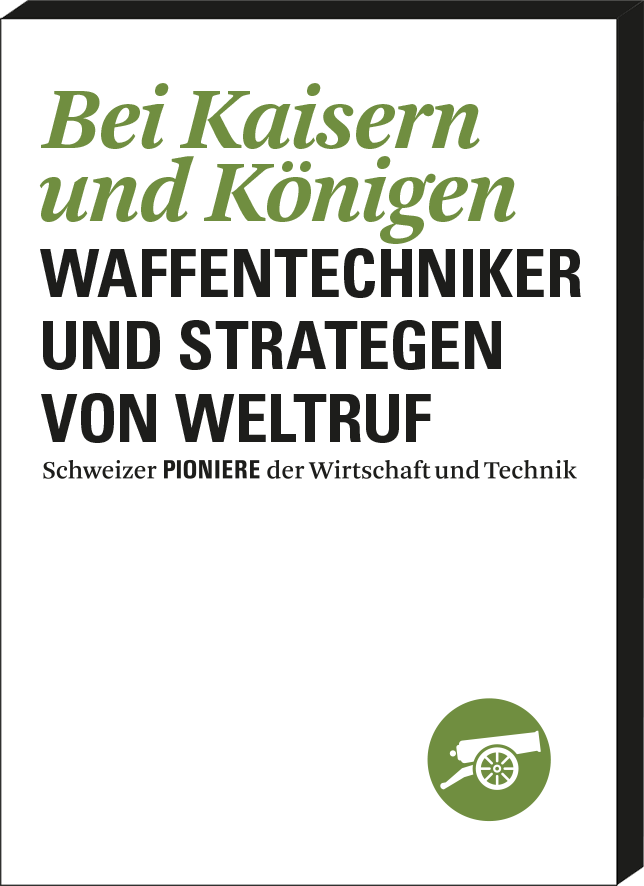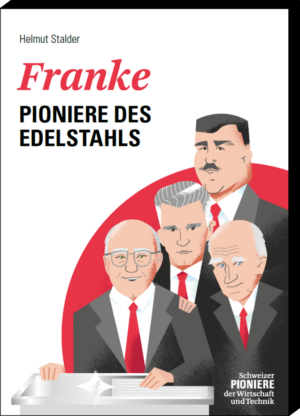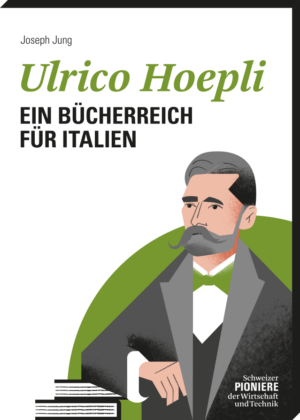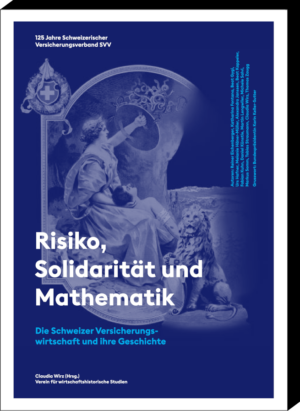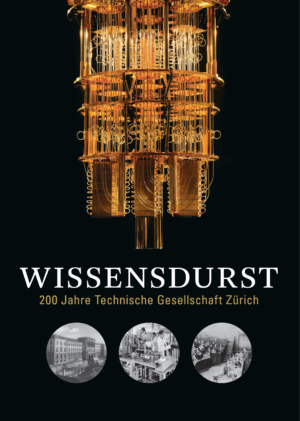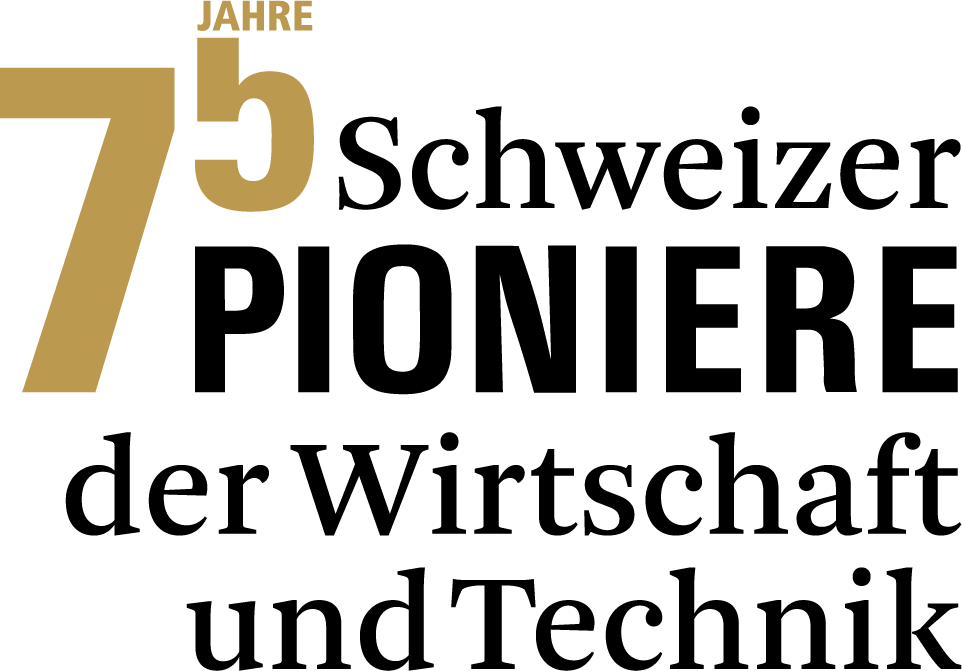Joseph Jung in «Neue Zürcher Zeitung», 3. November 2022, S. 30
Der grösste Brückenbauer des Landes
Vor 175 Jahren begann der Sonderbundskrieg. General Dufour führte ihn so, dass der Bundesstaat entstehen konnte.
Es fällt auf, dass in der Schweiz mit den Grossen des Landes ein sonderbarer Umgang gepflegt wird. Gewöhnlich redet man sie schlecht und stürzt sie über kurz oder lang vom Sockel. Nicht so Guillaume Henri Dufour. Mit der Umbenennung der Höchsten Spitze (4634 m ü. M.) in Dufourspitze setzte die Landesregierung 1863 ein unmissverständliches Zeichen. Dufour wurde wie kein anderer Schweizer des 19. Jahrhunderts idealisiert, zum Vorbild und Volkshelden gemacht. Strassen und Plätze sind nach ihm benannt. Für Dufour wurde aufmarschiert, komponiert, gedichtet und gesungen. Alles zu seiner grösseren Ehre, während die Liste der Objekte, die sein Konterfei trugen, länger und länger wurde.
Dass Dufour zu einer prägenden Figur der Schweizer Geschichte werden würde, stand nicht in den Sternen geschrieben. 1787 ist er in Konstanz zur Welt gekommen, seine liberal denkenden Eltern hatten Genf aus politischen Gründen verlassen. 1789 konnte die Familie nach Genf zurückkehren. Nach Abschluss des Gymnasiums blieb Guillaume Henri unschlüssig, wie es mit ihm beruflich weitergehen sollte. 1807 schrieb er sich an der École polytechnique in Paris ein. Diese Kaderschmiede für künftige technische Eliten war gleichzeitig auch Kadettenschule. Es folgte die École d’application de l’artillerie et du génie in Metz. 1811 traf der Dienstbefehl ein: Dufour wurde auf die ionische Insel Korfu geschickt.
Napoleons Niederlagen auf den europäischen Schlachtfeldern beendeten Dufours Karriere in der französischen Armee – den Kaiser behielt er aber auch nach Waterloo im Herzen. 1815 kehrte er nach Genf zurück. Zunächst Leiter des Militärwesens, wirkte Dufour bald schon als Kantonsingenieur. Mit dem Bau von pionierhaften Brücken und Quaianlagen und der Neugestaltung von Quartieren veränderte Dufours Handschrift das Genfer Stadtbild.
Humanitäre Kriegsführung
Nur ganz wenigen gelingt es, im helvetischen Pantheon Aufnahme zu finden. Dufour verfügte gleich über mehrere Eintrittstickets, denn in verschiedenen Disziplinen hat er für die Schweiz Grosses geleistet. Drei Mal war er im jungen Bundesstaat General: 1849 im Zusammenhang mit den Revolutionen in deutschen Staaten und der Flüchtlingsfrage, 1856/57 im drohenden Krieg gegen Preussen um Neuenburg, 1859, als die Schweiz Gefahr lief, in den Italienisch- Österreichischen Krieg hineingezogen zu werden. Als militärischer Stratege formulierte er die bewaffnete Neutralität, überzeugt davon, dass Existenz und Unabhängigkeit der Schweiz inmitten der europäischen Mächte nur so zu gewährleisten seien.
Wirtschaftlich fortschrittsorientiert, nahm er sich in Genf der Eisenbahnfrage an und setzte sich für die Errichtung der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich ein. Zwischen 1832 und 1864 erbrachte Dufour mit der Topografischen Karte der Schweiz eine Pionierleistung mit weltweiter Ausstrahlung. 1863 gehörte er zum Gründerkreis der internationalen Rotkreuzbewegung und wurde deren erster Präsident.
Doch über allem steht Dufour als General der eidgenössischen Truppen im Sonderbundskrieg von 1847. Sein Wirken lenkte den Bürgerkrieg in eine Richtung, die den jungen Bundesstaat überhaupt erst möglich machte. Dufours Geheimnis bestand darin, dass er das Geschehen nicht auf Zerstörung undn Vernichtung ausrichtete, sondern darauf, physische und emotionale Verletzungen möglichst gering zu halten und den Krieg auf schnellstem Weg zu beenden. Erst dies machte den Bundesstaat auch für die Verlierer zugänglich.
Es ist schwer vorstellbar, auf welcher Grundlage sich die Schweiz hätte entwickeln können, wenn man auf die Hardliner und ihre Hasstiraden gehört hätte, wenn die Bundestruppen 1847 von antiklerikalen und radikalen Fanatikern geführt worden wären. Als liberaler Calvinist, dem religiöser Fundamentalismus fremd war, konnte Dufour allen die Hand reichen; als Oberbefehlshaber, der gegen Miteidgenossen das Schwert zu ergreifen hatte und somit den schwierigsten Krieg führen musste, der einem General aufgetragen sein kann, wusste er, dass letztlich nicht Waffen und Gewalt zum Frieden führen, sondern Respekt und Versöhnung.
So paradox die Begrifflichkeit klingt: Dufours humanitäre Kriegsführung fand den Respekt auch der Verlierer. Dufour demonstrierte 1847, was später dank der Rotkreuzbewegung im Umgang mit Soldaten, Kriegsflüchtlingen und der Zivilbevölkerung als Standard formuliert werden sollte. Das war Dufours Glanztat, nicht das blanke Resultat des erzielten Sieges.
Die grosse Gefahr für die Bundestruppen drohte letztlich nicht vom Sonderbund, sondern von ausserhalb der Landesgrenzen in Form militärischer Interventionen namentlich Österreichs, Frankreichs und Preussens. Dass diese ausblieben, war wiederum massgeblich Dufours Kriegsführung zu verdanken. Zunächst wurden die ausländischen Mächte durch den schnellen Siegeszug der Bundestruppen überrascht. Dass sie im Herbst 1847 nicht in die Schweiz einmarschierten, hing ebenso mit der von Dufour befohlenen strikten Rücksichtnahme auf die Zivilbevölkerung und die Gefangenen zusammen. Wiewohl Übergriffe, Brandschatzungen und Plünderungen durch die eidgenössischen Truppen nicht ausblieben: Dufours Befehle waren unmissverständlich. Hätte sich indes der Bürgerkrieg in die Länge gezogen und wäre auf dem Schlachtfeld mehr und mehr Blut geflossen, dann hätte das Ausland die Rufe des Sonderbunds nach militärischer Hilfe wohl nicht länger überhören können.
Bemerkenswerte Ambivalenzen
Dufour ist keine lupenreine Heldenfigur. 1847 zögerte er zunächst, ob er die Wahl zum General und den Auftrag zur Auflösung des Sonderbunds annehmen sollte oder nicht. Angesichts des drohenden Kriegs gegen Preussen 1856/57 begab er sich neutralitätspolitisch auf gefährliches Gelände, indem er aus strategisch- taktischen Gründen präventiv vom Kanton Schaffhausen aus ins Grossherzogtum Baden einmarschieren wollte und damit auch den Krieg mit den süddeutschen Staaten riskierte. Die eigenen militärischen Kräfte überschätzte er masslos und deutete den preussischen Feldzugsplan falsch. Dufour provozierte eine veritable Staatskrise, weil er sich mehrfach zierte, den Befehlen der Landesregierung nachzukommen und Truppenkörper zu entlassen.
Bemerkenswerte Ambivalenzen zeigten sich auch in seiner politischen Haltung. Vom Personenkult und vom Bonapartismus liess sich Dufour blenden. Als Verehrer Napoleons I. fühlte er sich auch dessen Neffen Louis Napoleon verbunden. Dem späteren Napoleon III. hielt er die Stange, während dieser putschte, die Demokratie aushebelte und Oppositionelle en masse verhaftete. Im eidgenössischen Parlament, dem er ab 1848 mehrfach als National- oder Ständerat angehörte, fühlte sich Dufour nicht wohl, auch weil er den Debatten nicht folgen konnte, da er kein Deutsch sprach. Während sich in den Berner Wirtshäusern seine Kollegen abends die Flaschen um die Ohren schlugen, zog sich Dufour in sein Hotelzimmer zurück, um «David Copperfield» zu lesen und Horaz zu rezitieren.
Doch trotz allen Kratzspuren: Die Schweiz verdankt Dufour enorm viel. Er war ein Brückenbauer auch im übertragenen Sinn. Dank ihm fand die Schweiz im jungen Bundesstaat rasch zu einer verbindenden Identität – auch dank der militärischen Zentralschule in Thun, die Dufour über Jahrzehnte prägte. Er machte Offiziersausbildung und Truppenzusammenkünfte zu einem Transmissionsriemen eidgenössischen Selbstverständnisses. Im gemeinsamen Dienst und ganz besonders, wenn das Vaterland in Gefahr war, durchwuchs das Zusammengehörigkeitsgefühl alle sozialen Schichten. Wie Dufour aus 24 kartografischen Blättern das grosse Bild der Schweiz zusammensetzte, machte er aus Partikularisten Schweizerinnen und Schweizer.
Dass sich Freiburger, Schwyzer oder Urner nach 1848 bald als Schweizer fühlten, hing nicht mit den 1.-August- Feiern zusammen, die erstmals 1891 eingeführt wurden, erst recht nicht mit der Arbeitslosen- und Hinterlassenenversicherung, deren Versprechen von 1948 datiert. Und dass erst 1898 ein katholisch-konservativer Politiker in die Landesregierung eintreten konnte,
beschäftigte lediglich die Elite. Denn wer in den 1850er Jahren unter dem Kommando von General Dufour hinter der Schweizer Fahne marschierte, war bereit, für das Vaterland das Leben
zu opfern – ob reformiert oder katholisch, konservativ oder liberal, ob ehemaliger Sonderbündler oder Bundesmann. Dufour gibt die überzeugende Antwort auf die ewige Streitfrage der Geschichte, wer den Lauf der Dinge bestimme. Prozesse, Strukturen und Systeme mögen wichtig sein. Doch manchmal hängt alles an einer einzigen Person.
Link zum Artikel
![]()